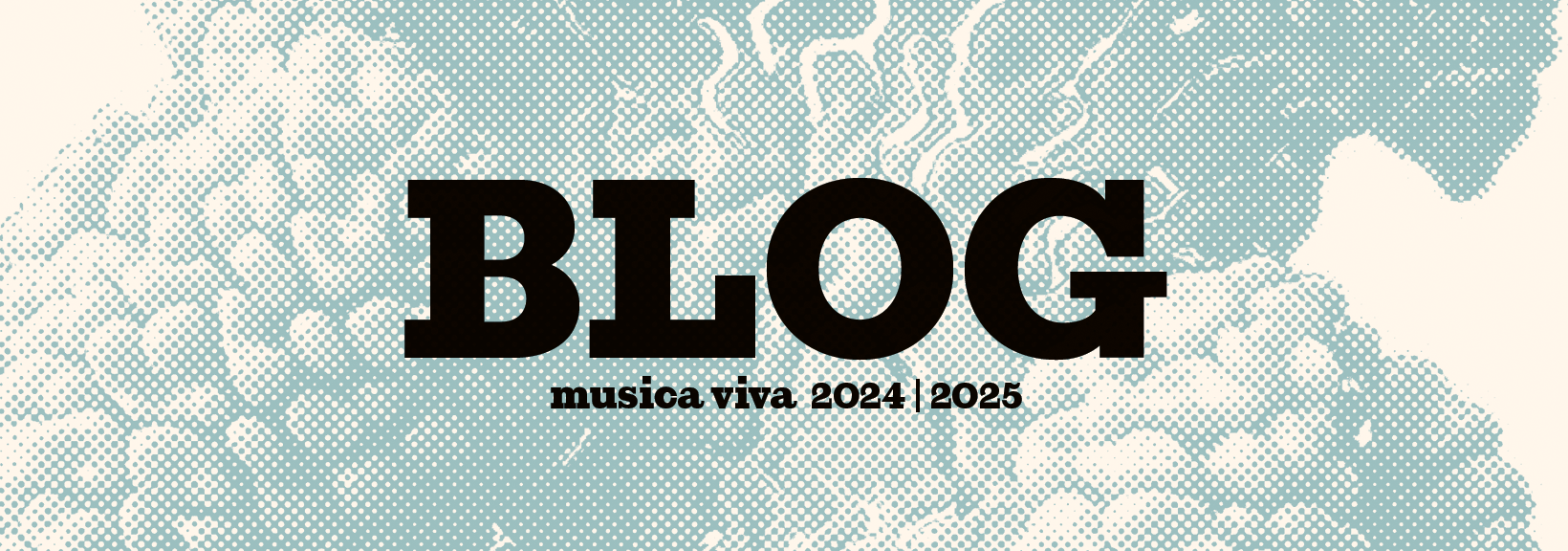
Blog
neueste Beiträge

Im musica viva-Konzert am 12. April 2024 übernimmt der Schlagzeuger Dirk Rothbrust den Solopart in Iannis Xenakis‘ Aïs für Bariton, Schlagzeug und Orchester.
Die Fotografin Astrid Ackermann traf ihn in Köln zu einem Interview in Bildern.

Dirk Rothbrust übernimmt im musica viva-Konzert am 12. April 2024 den Solopart am Schlagzeug in Iannis Xenakis‘ Komposition Aïs. Im Interview mit Julian Kämper spricht er über seinen Zugang zu diesem Werk und zu Iannis Xenakis‘ Musik.

Im musica viva-Konzert am 20. Dezember wird Bernhard Langs GAME 18 Radio Loops uraufgeführt: ein Kompositionsauftrag der musica viva/BR anlässlich 75 Jahre Bayerischer Rundfunk und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Dafür hörte sich der österreichische Komponist durch Audioarchivmaterial der ARD.